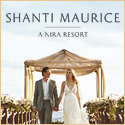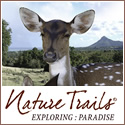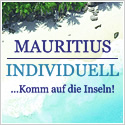Die mauritische Literaturszene hatte es nicht leicht, sich zu entwickeln: Während der Kolonialzeit galten einheimische Schriftsteller als Autoren zweiter Klasse. Aber auch heute noch werden junge Literaten weitgehend ignoriert. Nur langsam öffnet sich das Land seiner Heimatliteratur. Lesen Sie dazu diesen Artikel von Antje Allroggen.
Der Fluch der Palme
Die mauritische Literaturszene will sich von Klischees und ehemaligen Kolonialherren lösen
Von Antje Allroggen
Es ist wie ein Fluch: Wo immer ein mauritischer Schriftsteller auch lebt, wo immer er auch schreibt, die Kokospalme lässt ihn einfach nicht los. Die mauritische Schriftstellerin Ananda Devi, die seit mehreren Jahrzehnten in Genf wohnt, hat mit einer Novelle sogar den Versuch unternommen, vor diesem Paradies-Klischee bis in die Antarktis zu fliehen. Doch ihr Versuch ist wie der anderer Autoren gescheitert: Der mauritische Schriftsteller bleibt der Kokospalme verhaftet – ob er will oder nicht.
„Ich denke, es ist ganz klar, dass sich gerade Inselliteratur im Süden, frankofone Literatur von diesen Klischees nur schwer lösen können, weil einfach dieses Klischee aufgebaut wird vom westlichen Leser. Das darf man nicht unterschätzen, denn der Großteil dieser Literatur wird eben in Frankreich und England verlegt. Das heißt, dieser Blick, diese Erwartungshaltung der Exotik, die ist weiterhin da. Was interessant ist, dass eben einige Autoren sich einfach damit sagen, Teil einer Erneuerungsbewegung, Teil eins neuen identitätsschaffenden Diskurses ist es eben, sich gegen diese Exotik zu stellen. Aber natürlich auf sehr verschiedene Art und Weise. Dass sich sehr viele mauritische Autoren einer sogenannten Anti-Tropikalisierung verschreiben. Das heißt also absolut weggehen wollen von diesen idyllischen Lagunen Strand Sonnenuntergang usw. Pirogen-Bild, das aber inhärent ist in gewisser Weise“,
sagt der aus Deutschland stammende Markus Arnold, der von La Réunion aus über die postkoloniale Literatur im Indischen Ozean forscht. Spätestens seit der Jahrtausendwende ist die Gewalt zum Markenzeichen mauritischer Literatur geworden. Sie bildet nicht nur den Rahmen für die Handlung und richtet sich nicht nur gegen die „Oberen“, sondern manifestiert sich auch in vielen anderen Formen, so Arnold:
„Es gibt diese Literaturen, die man unter dem Label Postkolonial-Literaturen bezeichnen kann, die spielen mit diesem Thema schon seit dem Beginn, seit ihrer Geburt, mit den Antikolonialisierungsbewegungen und Postkolonien der 50er-, 60er-, 70er-Jahre usw. Was jetzt speziell ist in den letzten Jahren oder in den letzten zehn, 15 Jahren, dass es einfach auch einen Wechsel gibt in der Modalität, wie man diese Gewalt erzählt und bestimmte Ästhetiken verwendet, die vorher nicht da waren. Die Frage ist nicht mehr unbedingt allein: Was wird erzählt, sondern: Wie wird es erzählt.“
Angefangen hat diese neue Bewegung historisch gesehen mit dem Eintritt Mauritius‘ in die Unabhängigkeit vor 45 Jahren. Nachdem der kleine Inselstaat über Jahrhunderte von Kolonialstaaten – den Niederländern, den Franzosen, zuletzt den Briten – regiert worden war, war er plötzlich ganz auf sich allein gestellt.
Die vielen ethnischen und kulturellen Gruppen – in Reiseführern gerne als funktionierendes harmonisches Multikulti beschworen -, lebten auf Mauritius wie kleine Satelliten ihrer einstigen Heimatländer – Indien, Mosambik, Frankreich, England und China – und mussten trotz ihrer unüberwindbaren Unterschiedlichkeit in ein irgendwie demokratisch anmutendes Gleichgewicht gebracht werden. Den Übergang in die Souveränität erlebten die Mauritier als eine Zeit voller Armut und Orientierungslosigkeit, erinnert sich die Schriftstellerin Ananda Devi:
„Ich habe sehr früh als Kind, als Jugendliche zu schreiben angefangen. Und ich glaube, mein Blick auf das damalige Mauritius war ein sehr trauriger. Als Mauritius 1968 unabhängig geworden war, gab es hier sehr viel Armut. Ein Dritte-Welt-Land. Viele Menschen lebten unter sehr schwierigen Bedingungen. Und ich glaube, das hat mich als junge Autorin interessiert, diese Lebensumstände zu beschreiben, auch über Dinge, über die man damals auf Mauritius schwieg. Mein erster veröffentlichter Roman ist aus der Sicht einer jungen kreolischen Prostituierten aus Port Louis in der ersten Person geschrieben. Das hat die Leute damals schockiert. Ich kam zwar überhaupt nicht aus diesem Milieu, aber ich hatte mich in ihre Haut, in ihren Körper begeben, um ihre Geschichte zu erzählen. Seitdem habe ich nicht aufgehört, andere Personen zu bewohnen. Und oft – bedingt durch meine Leidenschaft zu schreiben – fesseln mich Erlebnisse von Gewalt und Tragik. Ich glaube, es ist wie die Entdeckung des menschlichen Seins, die Frage, was dem Menschen beim Erleiden von Gewalt geschieht.“
Das „neue“ unabhängige Mauritius legte Missstände in der Gesellschaft offen, die von den Kolonialstaaten lange kaschiert worden waren. Die gesellschaftliche Desorientierung mündete 1989 in einen regelrechten bürgerkriegsähnlichen Aufstand der Bevölkerung: Zum ersten Mal in der Geschichte von Mauritius formierte sich Widerstand, als Kaya, damals der populärste Sänger in Mauritius, während eines Konzerts auf der Bühne Marihuana rauchte und damit die Legalisierung der Droge propagieren wollte. Die Regierung griff noch während des Konzerts ein und nahm Kaya in Gewahrsam. Fünf Tage später, am 21. Februar, wurde der Sänger in seiner Zelle tot aufgefunden. Den offiziellen Angaben zufolge starb er durch einen Schädelbruch, den er sich selbst zugefügt haben soll. Die Bevölkerung reagierte auf diese politische Willkür entsetzt. Es kam zu tumultartigen Szenen.
Der mauritische Autor Carl de Souza hatte diesen Ereignissen 1999 einen Roman gewidmet: Das junge Mädchen Santee, im weiteren Verlauf auch Shakuntala genannt, irrt durch die Wirren der Nacht, sie hat ihren jüngeren Bruder Ram verloren. Auf ihrer Suche nach ihm begegnet sie zwielichtigen Personen, plündert ein Geschäft aus, verliebt sich in Ramesh, der einer anderen Religion als sie selber angehört, und entgeht nur knapp einem Selbstmordversuch. Der Aufstand der Massen entzweit das junge Geschwisterpaar, doch Bruder und Schwester bleiben auf der Suche nach sich selbst und dem anderen:
Er ist der kleine Bruder von niemandem, vor allem nicht von Santee, die völlig den Verstand verloren hat und sich nun im „Dino-Store“ amüsiert. Er ist Ram, und selbst darüber ist er sich nicht mehr wirklich sicher. Er ist irgendwie aus einem Käfig herausgekommen, ohne sich darüber aber wirklich bewusst zu sein. Shakuntala sagt dies, Shakuntala sagt das, du sollst dich nicht bewegen, nicht noch einmal abhauen, ohne vorher bescheid zu sagen. Du wirst dich jetzt ruhig in diesen Sessel hinsetzen. Das ist ja wohl nicht so schwer, oder?
De Souza ist mit diesem Roman einer der ersten mauritischen Schriftsteller, der die violence cachée, die plötzlich hinter dem friedlichen Bild der Insel zutage getreten war, literarisch thematisierte. De Souza ist damit auch einer der ersten Autoren des Inselarchipels, der an der Dekonstruktion des Paradiesmythos‘ aktiv beteiligt war.
„Die Dinge haben sich mir quasi aufgezwungen. Damals schrieb ich über gesellschaftliche Missstände auf Mauritius, den Streit der einzelnen ethnischen Gruppen untereinander. Und dann kam diese Revolte, die auf eine Person, Kaya, zurückzuführen war. Das war wie ein plötzliches Aufflackern einer Gewalt, auf die hier niemand gefasst gewesen war. Mit diesem Thema mussten wir uns nun auseinandersetzen. Diese Aufstände haben unsere Gesellschaft erschüttert. Ganz Mauritius war wie unter Schock. Vier Monate blieb die Insel in einer Starre, so als habe man Angst, dass das Monster noch einmal aufwachen könne. Danach habe ich zu schreiben angefangen, um die Unruhen zu verarbeiten.“
Auch andere Schriftsteller aus Mauritius erleben ihr Schreiben als ein therapeutisches, vielleicht auch engagiertes Schreiben, das, anders gemeint als im sartreschen Sinne, sich von früheren kolonialen Zwängen lossagt und dadurch soziale Bruchstellen in der mauritischen Gesellschaft deutlich benennt. Das Aufdecken von „Wahrheiten“ erlebt der Autor als Befreiung, die zur eigenen Selbstfindung dient, den Leser aber immer miteinbezieht. Markus Arnold:
„Der Begriff engagierte Literatur ist natürlich ein bisschen behaftet mit Sartre usw., aber generell sind alle Autoren Träger einer gewissen Message. Natürlich relativ subtil. Das postkoloniale Erbe ist noch sehr stark. Das sind junge Nationen, Brennpunkte, die noch diskutiert werden müssen, was das Patriarchat angeht, Gendergewalt, solche Dinge, die man in westlichen Demokratien nicht mehr so offen kennt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der da ist, und somit gestaltet sich auch diese violence, diese Gewalt, in den Romanen des Südens schon anders. Auch deswegen, weil sie, ob es eine gute Sache ist oder nicht, aber automatisch auch eine Repräsentation ist von dem Kollektiven, einer kollektiven Idee.“
Die Romane, die über Mauritius erzählen, werden auf der Insel selber nur von einer zu vernachlässigenden kleinen Bildungsschicht gelesen. Immerhin sind noch mehr als 13 Prozent der Inselbewohner Analphabeten. Viele Insulaner können sich den Kauf eines Buches schlichtweg nicht leisten. Die meisten mauritischen Schriftsteller leiden bis heute darunter, dass sie in ihrem Heimatland kaum jemand kennt. Ananda Devi:
„Ich schreibe jetzt schon seit 40 Jahren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich meine ersten Bücher, die übrigens zuerst von mauritischen Verlagen veröffentlicht wurden, in keiner einzigen Buchhandlung auf Mauritius fand. Zu dieser Zeit wurden die mauritischen Autoren hier auf der Insel wirklich ein wenig wie Autoren zweiter Klasse behandelt. Das hat mir damals wehgetan. Als meine späteren Bücher dann aber in ausländischen Verlagen veröffentlicht wurden, bei Gallimard, war ich auf einmal sehr angesehen auf Mauritius. Das Ausland brachte mir die Anerkennung in meinem Heimatland. Inzwischen interessieren sich die Mauritier sehr für meine Bücher, man bespricht sie in Seminaren an der Universität usw.“
Um die mauritische Literatur auch im eigenen Land bekannter zu machen, wurde vor etwas mehr als einer Woche der erste „Salon du livre“ auf Mauritius veranstaltet, der zahlreiche mauritische Autoren sowie Schriftsteller aus dem Ausland einlud und so erstmals eine literarische Bestandsaufnahme wagte. „Confluences“ nannte sich die Buchmesse vieldeutig und ließ den Inselstaat vor allem durch mauritische Autoren repräsentieren, die sowohl auf Mauritius, als auch im Ausland bereits zu einer gewissen Anerkennung gekommen sind. Die jüngere Generation fehlte komplett, ebenso die Gruppe der einheimischen Autoren, denen bisher noch keine Veröffentlichung in einem ausländischen Verlag geglückt ist. Immerhin versprach der mauritische Premierminister in seiner Eröffnungsrede, Texte mauritischer Autoren in den schulischen Lehrplan zu integrieren.
Auch der prominenteste Vertreter der mauritischen Literatur, Jean Marie Gustave le Clézio fehlte. Ein paar wohlwollende Worte über den Weltfrieden, vorgetragen von einem Weltgereisten mit mauritischen Wurzeln, hätten vielleicht dazu ermutigt, weniger zweitklassige Schriftsteller aus dem – vorwiegend französischen – Ausland einzuladen und stattdessen der Buchmesse mehr Raum zu geben, um eigene kulturelle und literarische Schätze zu heben.
Zahlreiche unveröffentlichte Texte früherer Autoren in den Archiven wären zu entdecken, ganz zu schweigen von den „Sirandas“: Volksmärchen, die in kreolischer Sprache auf Mauritius geschrieben wurden und von dort aus verändert auch andere Inseln im Indischen Ozean erreichten. In diesen Geschichten geht es übrigens sehr häufig um Engel, die Dämonen von der Insel Mauritius vertreiben. Man hätte einfach gerne mehr Autoren wie Amal Sewtohul auf der Messe gesehen, der einer Schriftstellergeneration nach Ananda Devi angehört und selbstironisch und übrigens relativ gewaltfrei die Palmenstrände von Mauritius nach Australien verortet und so der Verkitschung seines Inselparadieses mit viel Humor aus dem Weg geht.
Über die Autorin:
Antje Allroggen hat an den Universitäten Bonn und Nancy (Frankreich) Kunstgeschichte, Philosophie und Komparatistik studiert. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als Kultur– und Reisejournalistin für diverse ARD-Hörfunkanstalten, vor allem für den Deutschlandfunk. Journalistische Stipendien führten sie unter anderem nach Marokko und an die Duke University in North Carolina / USA. Mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern (zwei und acht Jahre) lebt sie für ein Jahr in Grand Baie/ Mauritius. Vielen Dank an Frau Allroggen und den Deutschlandfunk, die uns erlauben, die großartigen Geschichten und Beiträge für unsere Leser zu veröffentlichen!