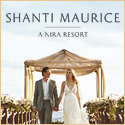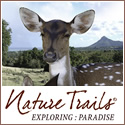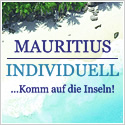Mauritius war lange ein Ort der Sklaverei – heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Längst hat der Tourismus auf der Insel Einzug gehalten. Der sagenumwobene Berg Le Morne, einst Zufluchtsstätte für viele Sklaven, ist einer der letzten Orte, der an die Geschichte der Ausbeutung erinnert und zu dem uns Antje Allroggen in ihrem Artikel mit nimmt.
Zufluchtsort mit Zauberkraft
Ein Felsen auf Mauritius erzählt die Geschichte der Sklavenzeit
Von Antje Allroggen
Eine Autofahrt in den Süden der Insel. Nur am Ende der Strecke führt die Straße direkt an der Küste entlang, ganz dicht an der Halbinsel Le Morne vorbei. Von hier aus zeigt sich der 556 Meter hohe Berg in seiner ganzen majestätischen Schroffheit: Seine Schauseite wendet sich dem Landesinneren zu, seine Rückseite weist aufs Meer. Beide Elemente verbinden sich und verschwinden gemeinsam im unendlichen Nichts des Indischen Ozeans.
Um den Morne und die Halbinsel, auf der er steht, ranken sich bizarre Geschichten – Sirandas. In kreolischer Sprache berichten sie von dunklen Dämonen, die auf dem Morne gegen kleine Engel kämpfen, am Ende dem Guten erliegen und in die Tiefen des Meeres gerissen werden.
„Die Sirandas oder auch erzählte Rätsel sind Teil unserer erzählten Literatur. Was den Morne anbetrifft, wissen wir von vielen Mythen und Legenden, die sich um diesen Berg oder seine Umgebung ranken. In den Geschichten ist von vielen Personen die Rede: von heldenhaften Figuren oder auch von Sklaven, die immer wieder in den unterschiedlichsten Versionen in den Sirandas auftauchen. Abends wird zum Beispiel gerne die Geschichte erzählt, dass sich am Fuße des Berges alte kettenrasselnde Schädel und auch Knochen befinden. Auch Sklaven tauchen in diesen Geschichten immer wieder auf,“
sagt Sophie Le Chartier, die auf Mauritius als selbstständige Anthropologin arbeitet, und erinnert an die berühmteste Geschichte, die dem Berg bis heute die Bezeichnung „Sklavenberg“ einbrachte:
Es mag um das Jahr 1810 gewesen sein. Eigentlich war im Zuge der Französischen Revolution auch auf der Île de France die Sklaverei abgeschafft. Doch die Metropole war weit weg, und die Kolonialherren mussten ihre Plantagen bestellen. Viele Sklaven blieben, einige wenige flüchteten und fanden als Zufluchtsstätte den Berg Le Morne. Damals noch eng bewaldet, gründeten sie am Fuße des Berges kleine Siedlungen oder versteckten sich in Höhlen oder Grotten. Als die Engländer Mauritius beherrschten und sie die Sklaverei sogar verboten hatten, schickten die neuen Kolonialherren der Insel Polizisten in die Region. Sie sollten den Sklaven die gute Nachricht bringen, dass sie endlich frei seien. Die Sklaven jedoch fürchteten erneut die Fesseln ihrer gerade erst gewonnenen Freiheit und stürzten sich vor Verzweiflung von den Klippen des Berges in den Tod.
Eine Tragik, die sich bis heute fest in die kreolische Kultur der Insel eingemeißelt hat und Stoff für viele weitere Legenden war:
„Diese Geschichten sind alle in der Zeit der Sklavenbefreiung entstanden. Es gibt Sirandas, die von dem Klippen-Sturz der Sklaven berichten. Andere Geschichten wiederum sagen, dass die Sklaven ein junges Mädchen eines englischen Kolonialherren gekidnappt haben, als die Soldaten am Morne anrückten.“
Wenn es zumindest wahr ist, dass sich viele Sklaven vom Berg Le Morne herabstürzten, ist dieser Vorfall in diesem Jahr etwas mehr als 200 Jahre her. Alljährlich erinnern sich die Mauritier am 1. Februar an diesen Tag. Viele pilgern dann zum Le Morne und tanzen Sega – die Musik, die die Sklaven nach Mauritius brachten und die von der katholischen Kirche lange verboten worden war, weil sie als sittenwidrig galt. Danach besuchen sie die kleine Gedenkstätte am Fuße des Berges, die heute noch an die glücklosen Sklaven erinnert.
Seitdem die UNESCO Le Morne im Jahr 2008 als Kulturlandschaft in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen hat, hat sich die Erinnerung an die Sklavenzeit tiefer in das Bewusstsein vieler Mauritier eingeschrieben. Denn hier, im Südwesten der Insel, lebten die meisten von ihnen. Robi Verloppe, ein junger Mann, weiß erst seit Kurzem um seine Wurzeln. Er wohnt in Le Morne, dem Dörfchen, das am Fuße des Berges liegt. Mithilfe der UNESCO hat er gelernt, die Ravanne zu spielen. Eine Trommel, in etwa so groß wie ein Tamburin, die in der ursprünglichen Sega-Musik auf Mauritius gespielt wurde. Vermutlich haben die Sklaven die Ravanne aus Afrika mit auf die Insel gebracht. In den vergangenen Jahrzehnten war sie auf Mauritius in Vergessenheit geraten.
„Die Ravanne erzählt von früher. Alle unsere Vorfahren spielten auf ihr. Ich stamme unmittelbar von den Sklaven ab, und es ist eine Ehre für mich, die Ravanne zu spielen. Viel hat sich seither geändert. Der Morne ist Weltkulturerbe geworden, darauf bin ich stolz. Seitdem ich klein bin, spielt die ganze Familie auf der Ravanne.“
„Abaim“ nennt sich die kleine Musikgruppe, die die Sega ganz vom touristischen Kitsch befreit und zu ihren musikalischen Ursprüngen wieder zurückführt.
Auch Jananne ist in Le Morne aufgewachsen. Ihre Vorfahren arbeiteten als Sklaven auf den Zuckerrohr-Plantagen der wohlhabenden weißen Franko-Mauritier. Im kommenden Jahr wird sie 60. Das Leben hat sie gezeichnet und lässt sie viel älter erscheinen, als sie ist. Ihre weißen Zähne funkeln wie kleine weiße Korallenmuscheln in der hellen Sonne – auch als Jannane anfängt, in kreolischer Sprache von den Mühen des Alltags einer typischen Familie aus Le Morne zu erzählen:
„Früher gab es hier sehr viele Leute ohne Arbeit. Man angelte sich einen kleinen Fisch im Meer. Manchmal gab es auch Probleme mit der Polizei, manchmal fand man Arbeit in einem Hotel, aber um dort arbeiten zu dürfen, braucht man eine Genehmigung, ein Zertifikat. Ich bin nicht zur Schule gegangen, kann nicht lesen. Es war hart. Wir lebten in Armut. Alle Frauen haben hart gearbeitet. Sie haben Holz gehackt oder in den Zuckerrohrfeldern gearbeitet. Manchmal zerstörten die großen Regenfälle unsere kleinen Häuser. In denen gab es oft nur Matratzen aus Stroh. So wie in dieser Hütte hier. Darauf musste man dann schlafen.“
Vor Kurzem lebte Jannane all das noch einmal durch. Um sie herum standen plötzlich wieder die Strohhütten, aus Palmenblättern und Zuckerrohr geflochten, in denen sie noch gelebt hat, als sie eine junge Familie hatte. Gemeinsam mit anderen Frauen stampft sie nun frische Kaffeebohnen in einem großen Mörser.
„Das sind die Kaffeebohnen, die wir mit dem Mörser zerstampfen. Es gibt immer noch guten Kaffee auf Mauritius, wie damals. Den Kaffee aus Chamarel. Die Bohnen werden in der Sonne getrocknet. Heute wird der Kaffee für die teuren Hotels, für die Geschäftswelt hergestellt. Wir können ihn uns nicht leisten, er ist zu teuer. Es ist einer der besten Kaffees und riecht so gut!“
Jananne trägt ein adrettes blau-weiß kariertes Kleid und um ihr Haar einen roten Turban. So sah die Arbeitskleidung für die Sklaven und die Leiharbeiter aus, die für die mehr als wohlhabenden Plantagenbesitzer arbeiteten. Und auch heute noch trägt das Personal, das sich viele auf Mauritius immer noch leisten, eine ganz ähnliche Uniform. Zum ersten Mal in der Museumsgeschichte von Mauritius hatte man das ursprüngliche Sklavendorf Trou Chenille naturgetreu rekonstruiert, um Touristen, aber auch Einheimische an die Lebensbedingungen der ersten Einwanderer auf Mauritius zu erinnern. Das originale Dorf – angeblich das erste, in dem die Sklaven einst siedelten – liegt an der südlichen Seite vom Berg Le Morne. Teile dieses Dorfes gibt es noch. Sogar ein alter Sklavenfriedhof ist noch vorhanden. Bei einer archäologischen Ausgrabung fand man neben allerlei Skeletten auch Perlenknöpfe, Münzen und etliche Pfeifen. Sowohl der Friedhof als auch Trou Chenille bleiben für die Öffentlichkeit jedoch versperrt. Das Gelände befindet sich in Privatbesitz einer franko-mauritischen Familie. Touristen können den Berg nur eingeschränkt besteigen, erzählt Sophie Le Chartier:
„Es gibt einen Weg auf den Le Morne hinauf, das ist allerdings nicht der originale Weg, der an Trou Chenille herbeiführt. Zu meiner Kindheit konnte man den Berg noch auf dem anderen Weg besteigen, ich erinnere mich noch an Fotos. Aber was ist von all dem heute übrig geblieben? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich habe nie Zugang zu Trou Chenille bekommen. Es wäre gut, wenn man das Dorf wieder originalgetreu aufbauen könnte, es ist ein historisches Dorf, das erste, das es am Le Morne gab. Hoffen wir, dass es eines Tages passieren wird.“
Nicht nur Archäologen und Ethnologen, auch die UNESCO fühlt sich in ihrer Arbeit rund um die Kulturlandschaft von Le Morne blockiert. Man hört davon, dass es am Küstenabschnitt von Trou Chenille Probleme mit der Erosion geben soll – Genaueres weiß man nicht. Auch Flora und Fauna haben sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert. Hotels sind in unmittelbarer Nähe des noch immer ärmlichen Dörfchens entstanden, freie Flächen mussten weichen.
Einst fanden die Sklaven viele Heilpflanzen am Fuße des Berges, mit denen sie die Naturmedizin, die sie aus ihren Heimatländern kannten, auch hier auf Mauritius weiterhin praktizierten. Noch leben in Le Morne und in den benachbarten Dörfern einige ältere Leute, die davon überzeugt sind, dass sie nur mithilfe dieser Medizin noch am Leben sind. Die einst mystische Gegend um den Sklavenberg hat an Zauberkraft verloren. Schön ist sie immer noch.
Immerhin plant man auf Mauritius ein Museum, das an die Zeit der Sklaven auf dem Archipel erinnern soll. An diesem Tag wird dieser Teil der Inselgeschichte sehr lebendig: Kinder aus einer naheliegenden Schule sind zum Le Morne gekommen, sie singen in historischen Hängerkleidchen zu alten Abzählreimen. Frauen tanzen Sega in gewagten bauchfreien Kleidern, ein Mann flicht Körbe aus Palmenblätterwedeln. Ein Museum zum Angucken, Anfassen und Anhören. Doch nach wenigen Tagen schon werden die Schautafeln wieder eingepackt und die Hütten abgebaut. Männer, Frauen und Kinder haben die karierte Kleidung wieder abgelegt. Nun sitzen sie am Strand, fangen sich einen Fisch und träumen weiterhin von einem paradiesischen Leben im Süden von Mauritius.
Über die Autorin:
Antje Allroggen hat an den Universitäten Bonn und Nancy (Frankreich) Kunstgeschichte, Philosophie und Komparatistik studiert. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als Kultur– und Reisejournalistin für diverse ARD-Hörfunkanstalten, vor allem für den Deutschlandfunk. Journalistische Stipendien führten sie unter anderem nach Marokko und an die Duke University in North Carolina / USA. Mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern (zwei und acht Jahre) lebt sie für ein Jahr in Grand Baie/ Mauritius. Vielen Dank an Frau Allroggen und den Deutschlandfunk, die uns erlauben, die großartigen Geschichten und Beiträge für unsere Leser zu veröffentlichen!