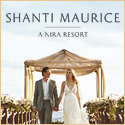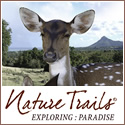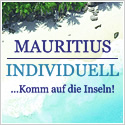Jean-Claude Antoine ist einer der bekanntesten Journalisten der Insel. Er arbeitet als Autor der Zeitschrift Week End in der Hauptstadt Port Louis. Der Artikel wurde ursprünglich im wunderbaren MERIAN Heft „Mauritius und Réunion“ veröffentlicht. Wir freuen uns über die Möglichkeit, ihn auch hier publizieren zu können. Ina Kronenberger übersetzte den Text aus dem Französischen.
„Ein Paradies für die Welt“ von Jean-Claude Antoine
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Mauritius in den siebziger Jahren verlassen. Damals, ich ging auf eine Reise nach Europa und Kanada, war Mauritius eine kleine, kaum bekannte Insel, umspült von den Tiefen des Indischen Ozeans. Jedes Mal, wenn ich im Ausland den Namen meiner Heimat erwähnte, musste ich eine geografische Lagebeschreibung hinterherschicken. Ich nahm eine Weltkarte zu Hilfe, führte meine Finger durch Europa und den gesamten afrikanischen Kontinent, bevor ich nach Osten Richtung Madagaskar abzweigte und den winzigen Punkt erreichte, der für Mauritius steht. Wenn ich heute auf Reisen bin und meine Heimat erwähne, bekomme ich auf der ganzen Welt die gleiche Reaktion: „Sie kommen aus Mauritius! Aus dem Paradies!“ Mich wundert selbst, wie es meine kleine Insel geschafft hat, binnen 30 Jahren zum Synonym für das Paradies auf Erden zu werden.
Schon lange bevor der Tourismus boomte, genoss meine kleine Insel – rund 60 mal 40 Kilometer groß – in einigen Teilen der Welt hohes Ansehen, wenn auch lange niemand auf ihr Fuß fasste. Erste Spuren ihrer Existenz sind auf den mittelalterlichen Karten arabischer Seefahrer zu sehen, die ihr den Namen Dina Arobi gaben. Offiziell entdeckt wurde die Insel im Februar 1507 von den Portugiesen, sie nannten sie Ilha do Cerne – Schwaneninsel – ließen sich aber nicht auf ihr nieder. Erst 91 Jahre später kamen die Holländer. Sie tauften die Insel zu Ehren des niederländischen Prinzen Moritz von Nassau auf den Namen Mauritius und machten einen Teil der Küste urbar. Zuckerrohr, Rotwild und Affen brachten sie mit auf die Insel, bauten Häuser und Festungen. Gleichzeitig holzten sie die dichten Ebenholzwälder ab, um das Holz nach Europa zu schiffen und rotteten die flugunfähige und zu ihrem eigenen Unglück viel zu zahme und an Feinde nicht gewöhnte Dronte aus, den Vogel, der als Dodo postum zum Nationalsymbol und Souvenir-Schlager der Insel avanciert ist. Als kein Edelholz mehr zu holen und das Ökosystem schwer geschädigt war, verließen die Holländer 1710 ihre Kolonie.
Fünf Jahre blieb sie weitgehend unbewohnt – bis die Franzosen sie annektierten. Aus Mauritius wurde die Île de France, ihre Lage machte sie mit einem Mal zur gefragten und umkämpften Zwischenstation auf dem Seeweg nach Indien. Im späten 18. Jahrhundert war die Hauptstadt Port Louis ein ebenso wichtiger Hafen wie Bombay oder Kalkutta. Um die Kontrolle der Insel brach ein erbarmungsloser Krieg zwischen Engländern und Franzosen aus. Französische Korsaren wählten die Île de France zur Basis in ihrem Kampf gegen die englische Marine und Handelsflotte. Schon damals war Mauritius bekannt und begehrt als „Stern und Schlüssel zum Indischen Ozean“.
Der erste bekannt gewordene Vergleich mit dem Paradies kam später. Als Mark Twain im 19. Jahrhundert Mauritius besuchte, schrieb er, Gott habe zuerst die Insel erschaffen und dann das Paradies nach ihrem Vorbild. Aber wer lebt im Paradies? Schon in den siebziger Jahren wurde ich bei meiner ersten Auslandsreise gefragt, wer die Mauritier seien, und selbst heute, wo die Welt zwar die weißen Strände, das klare Wasser und die komfortablen Hotels meiner Insel kennt, haben viele Menschen nur ein nebulöses Bild von ihren Bewohnern. Die Antwort ist damals wie heute die Gleiche: Der Mauritier denkt Französisch, schreibt Englisch, spricht Kreol, eine Sprache, die auf dem Französischen basiert und mit englischen, indischen, arabischen, chinesischen und afrikanischen Ausdrücken gespickt ist. Er ist empfänglich für den Rhythmus eines afrikanischen Tamtam, wobei er zugleich die feinen Töne einer europäischen Geige, einer indischen Zither oder einer chinesischen Laute zu schätzen weiß. Auf seinem Speisezettel finden sich neben einem französischen Ragout mit aller Selbstverständlichkeit chinesische Nudeln, ein indisches Curry oder afrikanisches Gemüse. Es ist normal für ihn, dass er auf dem Weg zu einer katholischen Kirche an einer moslemischen Moschee vorbeikommt und mehrere hinduistische Tempel und chinesische Pagoden passiert. Zu seinen Nationalfeiertagen gehören das christliche Weihnachtsfest, das hinduistische Maha Shivaratree, das chinesische Neujahrsfest, der Unabhängigkeitstag und das Opferfest der Moslems.
Die mauritische Bevölkerung ist das Ergebnis einer langwierigen und intensiven Vermischung verschiedener Rassen, Kulturen und Religionen, viele davon kamen nicht freiwillig auf die Insel. Die Holländer hatten afrikanische Sklaven im Schlepptau, als sie die Insel besiedelten, brachten aber auch Melanesier aus ihren asiatischen Kolonien mit. Aus Indien kamen Handwerker, genauer gesagt Tamilen aus Pondicherry, die beim Bau von Brücken und Straßen halfen. Französische Adelige, die während der Französischen Revolution auf der Insel Exil bezogen, kauften Sklaven aus Afrika und Madagaskar und ließen sie das Zuckerrohr auf Plantagen schneiden, die ihnen die Kolonialregierung
für den Neuanfang unterstellt hatte. (Ihre alten Titel durften die Herrschaften dabei behalten.) Als 1835 die Sklaverei unter der Herrschaft der Engländer abgeschafft wurde, weigerten sich die meisten nun freien Schwarzen, weiter auf den Plantagen zu arbeiten. Der englischen Kolonialregierung blieb nichts anderes übrig, als Landarbeiter aus Indien ins Land zu holen, um die Sklaven zu ersetzen. Die Inder kamen zu Zigtausenden. „Engagés“, Freiwillige, wurden sie genannt, weil sie einen Arbeitsvertrag bekamen, während die Sklaven noch mit Gewalt verschleppt worden waren. Dennoch waren ihre Arbeitsbedingungen kaum besser. Viele indische Kulis blieben ihr Leben lang auf der Insel, sparten das bisschen Geld, das sie auf den Plantagen verdienten und kauften dafür eigenes Land.
Heute stellen die Indo-Mauritier rund die Hälfte der Bevölkerung. Zeitgleich mit den ersten indischen Kulis kamen auch moslemische Kaufleute nach Mauritius, die sich nach mehreren Aufenthalten endgültig auf der Insel niederließen. Chinesische Einwanderer
übernahmen rasch die Kontrolle über den Einzelhandel, indem sie in den entlegensten Gegenden der Insel Läden eröffneten. Nachfahren der Inder, Franzosen, Chinesen, Araber und der Sklaven aus Afrika und Madagaskar bilden heute die gemischte, vielfältige Bevölkerung der Insel: eine der wenigen echten multikulturellen Gesellschaften der Welt. Allerdings ist auch diese Gesellschaft nicht frei von Problemen. Es gab in ihrer Geschichte immer wieder Ressentiments, um nicht zu sagen eine abgrundtiefe Feindseligkeit zwischen der schwarzen Mehrheit und der weißen Minderheit. Über Generationen wurde diese Abneigung weitervererbt. Ihre Wurzeln liegen in der Zeit der Sklaverei, in der die Kolonialherren, vom Gesetz protegiert und von der Kirche unterstützt, die Sklaven nicht als Menschen, sondern als Lasttiere ansahen, über die sie nach Gutdünken verfügen konnten. Auch nach dem Ende der Sklaverei hielten sich viele Weiße nach wie vor für Angehörige einer überlegenen Rasse.
Doch im Lauf der Zeit hat sich die Perspektive verschoben. Rassenzugehörigkeit und Überlegenheitsfantasien verloren an Bedeutung, wichtiger wurden Leistung, Können, Verdienst. Mit dieser Haltung ging meine Insel in eine der wohl bedeutendsten Phasen ihrer Geschichte: den Kampf um die Unabhängigkeit in den sechziger Jahren. Wie nicht anders zu erwarten, stellte sich die weiße Oligarchie gegen die Unabhängigkeit, wie sie sich Jahre zuvor – ebenfalls ohne Erfolg – gegen die Einführung des allgemeinen Wahlrechts gestellt hatte. Die weiße Minderheit propagierte eine engere Verbindung und eine umfassendere Abhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien, während das Gros der mauritischen Bevölkerung die Unabhängigkeit forderte. Die Wahlen 1967 bescherten der Unabhängigkeitsbewegung den Sieg, und ein Jahr später, am 12.März 1968, reihte sich die Insel in die Riege der freien Nationen ein. Mauritier jedweder politischen Couleur waren nun dazu verurteilt, unabhängig von der geografischen, kulturellen und religiösen Herkunft ihrer Vorfahren in einem Land zusammenzuleben. Sie hatten und haben auch heute keine andere Wahl, als miteinander auszukommen, sie müssen die Vergangenheit hinter sich lassen, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Auf meiner Insel gelingt das gut, wir haben gelernt, die Eigenheiten unserer Nachbarn zu entdecken und gern auch zu übernehmen. Die Öffnung hin zu den anderen hat meiner Meinung nach das bedingt, was Mauritius in den Augen der Welt zum Paradies macht: seine Gastfreundschaft. Ich rede dabei nicht von antrainiertem Lächeln oder von freundlichen Sätzen, die in Kommunikationstrainings durchexerziert werden, sondern ich meine eine ganz natürliche Neigung, eine angeborene
Freundlichkeit, gepaart mit Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber dem Gast, die den Mauritier dazu bewegt, den Besucher aufzunehmen, ihm sein Land zu zeigen und seine Schönheit mit ihm zu teilen.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß Bescheid über die unangenehmen Nebenwirkungen des Tourismus, kenne die Umweltschutzdiskussion und Spekulationen über Gewinne und Verluste. Aber ich bin Mauritier, und deshalb kann ich nicht anders. Ich lade Sie ein, das Paradies zu entdecken. Und es mit mir zu teilen.